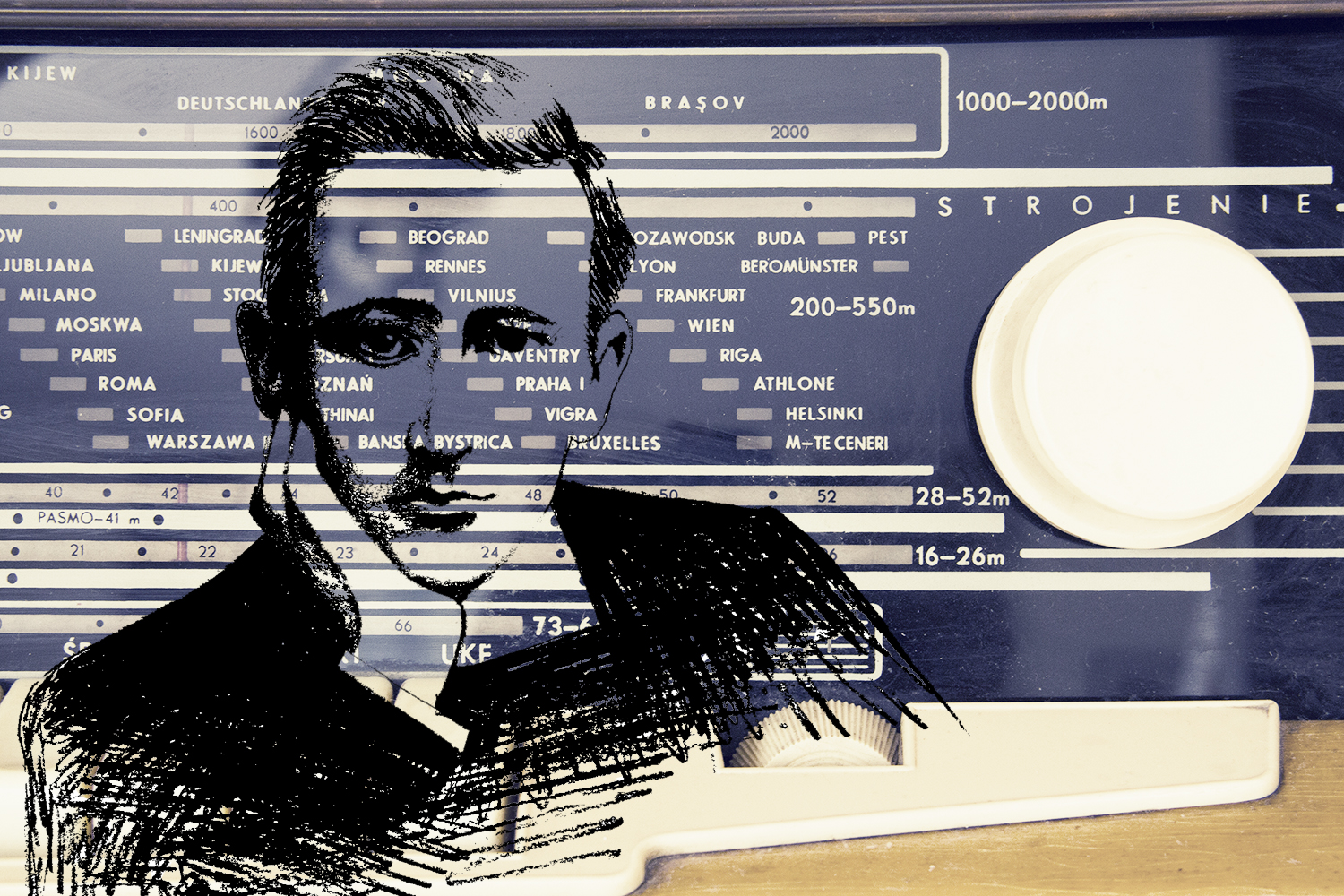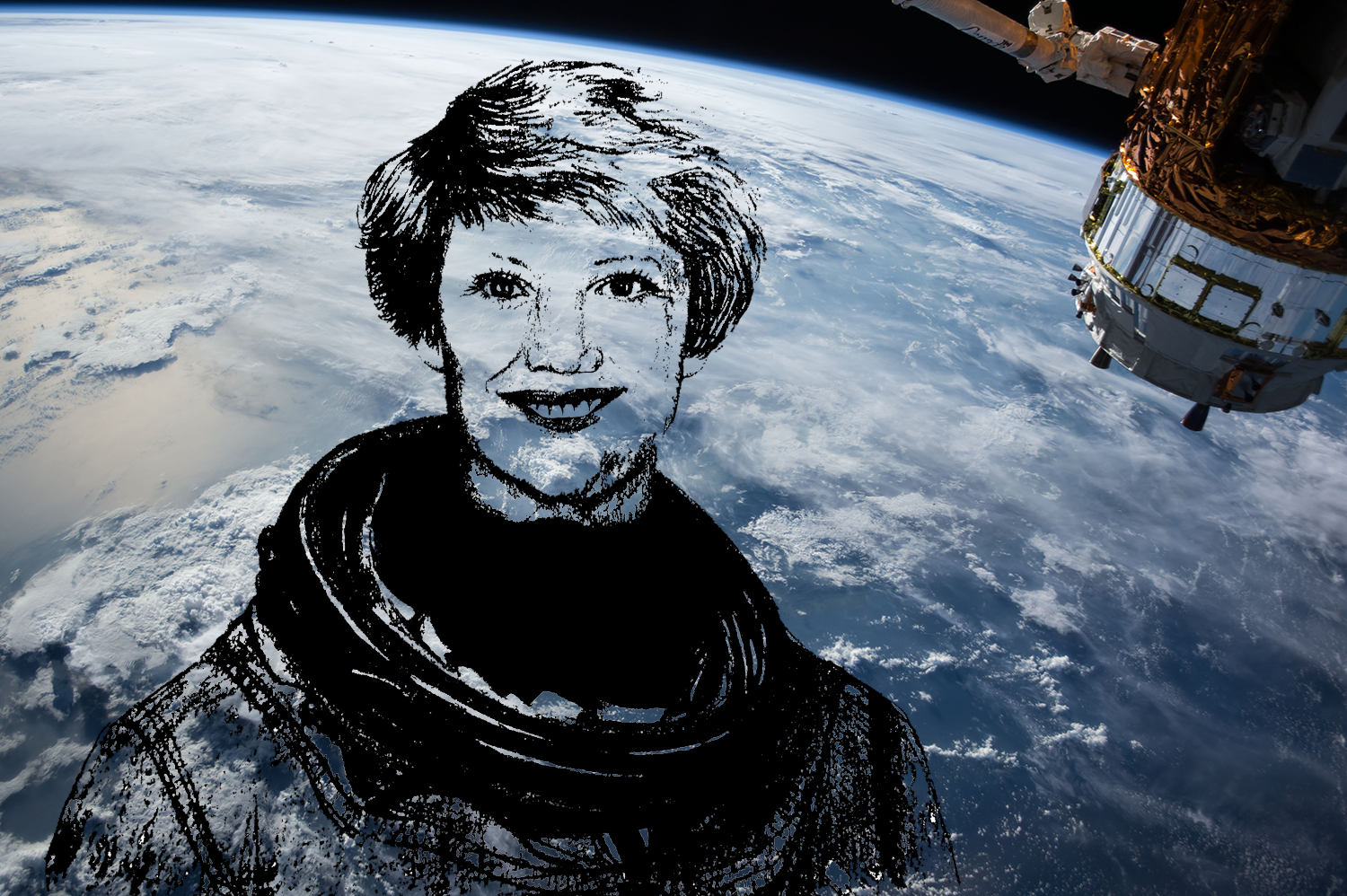Marie Curie: Eine Pionierin der Wissenschaft
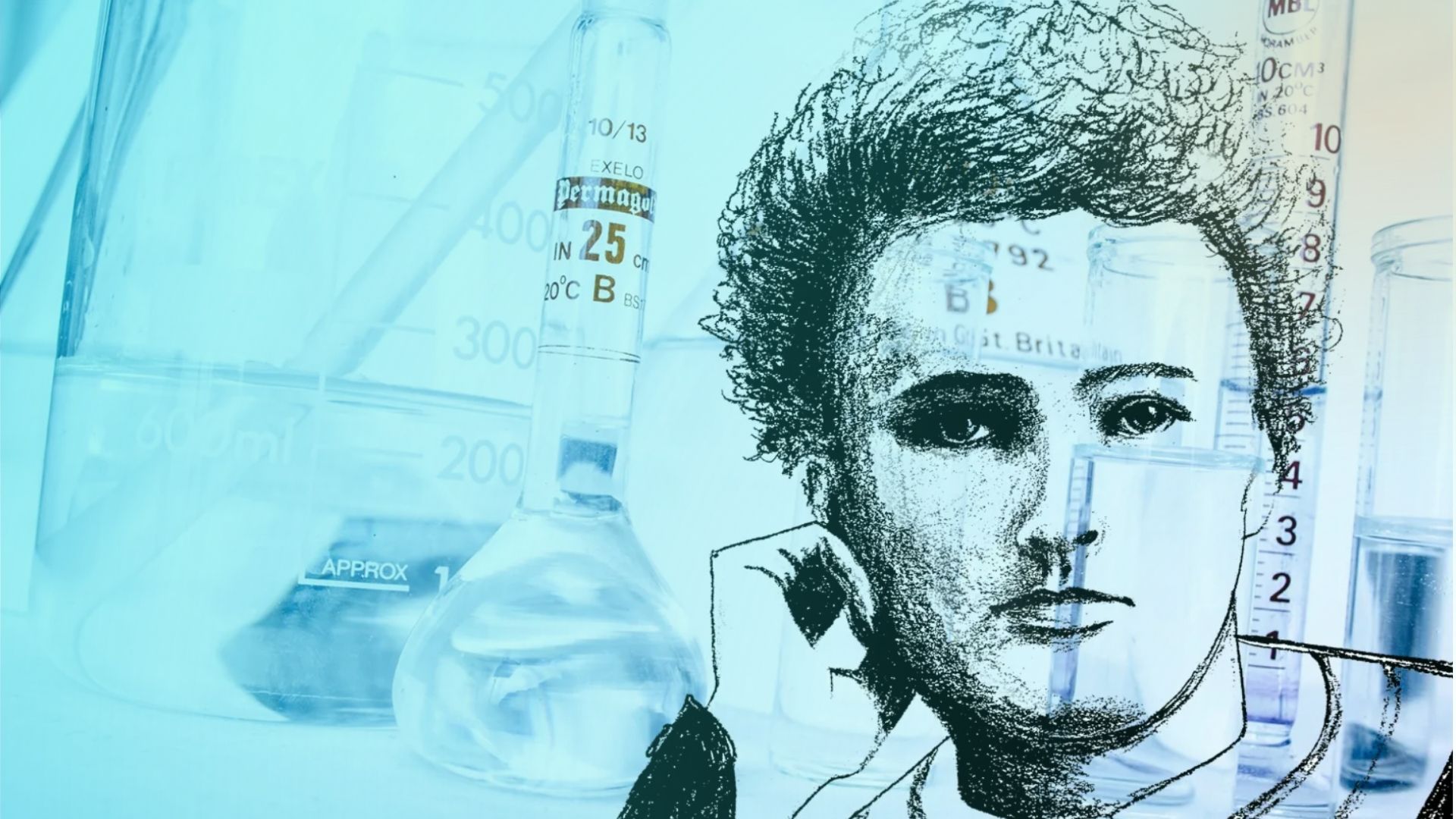
1867 wird in Warschau ein zartes, kleines Mädchen geboren. Der Novembertag ist kalt und regnerisch, und Bronisława und Władysław Skłodowski beugen sich über das fünfte ihrer Kinder. Eine Petroleumlampe leuchtet hell in das kleine Gesicht. Dieses Mädchen würde einmal Geschichte schreiben.
Eine harte Kindheit in Polen
Maria Skłodowski wächst in einer Zeit heran, die von Aufständen, Unterdrückung und Reformen geprägt ist. Polen war im 18. Jahrhundert den Machtinteressen von den anliegenden Großmächten unterworfen und zerteilt worden. Polen verschwindet von der Landkarte und bleibt auch bis 1918 als souveräner Staat verschwunden. Doch Polens Untergrund lebt. Bauern, Bürger und Intellektuelle organisieren Aufstände, die jedoch stets blutig niedergeschlagen werden. Marias Eltern gehören dem polnischen Niederadel an, sie sind beide Lehrer und zählen zur polnischen Intelligenzija. Doch nachdem Bronisława ein Jahr nach Marias Geburt an Tuberkulose erkrankt, hat die Familie mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Maria ist ambitioniert und intelligent, und obwohl ihre Mutter noch während ihrer Schulzeit stirbt, besteht sie ihr Abitur schließlich mit 15 Jahren als Klassenbeste.
Der Weg zur Wissenschaft
Frauen dürfen in Polen jedoch nicht studieren und ein Auslandsstudium ist aufgrund der finanziellen Situation der Familie völlig ausgeschlossen. Also schließt sie mit ihrer älteren Schwester Bronia einen Pakt: Maria arbeitet als Gouvernante und Hauslehrerin und bezahlt von dem Lohn das Medizinstudium ihrer Schwester. Maria nutzt die Zeit, um sich mit verschiedenen Wissenschaften auseinanderzusetzen. Jeden Abend sitzt sie in ihrem Mädchenzimmer und liest bis sie über den Büchern einschläft. Schließlich fällt ihr Augenmerk auf die Physik. Mit 23 Jahren schreibt sie sich als eine von 23 Frauen an der naturwissenschaftlichen Fakultät der Pariser Sorbonne-Universität ein. Hier soll eine außergewöhnliche Karriere folgen. Maria ist in beinahe jedem Fach die Beste. Sie ist fleißig und bestrebt. Nur drei Jahre später erwirbt sie das Lizenziat für Mathematik, erwirbt außerdem wenig später die Agrégation, den Abschluss, der sie dazu berechtigt, an einer höheren Mädchenschule zu lehren. Dies ermöglicht ihr ein eigenes Einkommen. Sie muss unabhängig sein, um ihre Forschung zu bezahlen.
Marie Curie: Die Entdeckung der Radioaktivität
1894: Maria, die inzwischen immer öfter den Namen Marie verwendet, erhält von der Gesellschaft zur Förderung der Nationalindustrie ihren ersten Forschungsauftrag: Sie soll die magnetischen Eigenschaften verschiedener Stahlsorten untersuchen. Das Laboratorium, in dem sie die Untersuchungen durchführt, wird von Pierre Curie geleitet. Es vergeht ein Jahr, in dem aus den beiden Laborpartnern ein Liebespaar wird. In dem Jahr, in dem sie Pierre schließlich heiratet, wird die Röntgenstrahlung durch Wilhelm Röntgen entdeckt. Kurz darauf entdeckt Antoine Henry Becquerel die Becquerel-Strahlung. Beide werden zum Gegenstand von Marie Curies Forschung.
Umgeben von radioaktivem Material hinterlässt die Forschung an Marie Curie 1898 das erste Mal ihre Spuren. An ihren Fingerspitzen stellt sie eine Entzündung fest, die sie dokumentiert und die später als die ersten Symptome der Strahlenkrankheit gelten sollen. Die schlanke, zierliche Frau arbeitet jeden Tag daran, das verbleibende, unbekannte Element zu finden. Schließlich entdeckt sie es: Radium.
Erfolge und Tragödien
1902 kann Marie Curie ein Dezigramm Radiumchlorid gewinnen und so die Atommasse des Radiums bestimmen. Sie wird als erste Frau als Lehrerin für Physik an die ENSJF – École normale supérieure de jeunes filles berufen – Frankreichs renommierteste Lehranstalt für zukünftige Lehrerinnen
Das Leben von Marie Curie für die Wissenschaft
Doch die Curies haben den Höhepunkt ihrer Forscherkarriere noch nicht erreicht. Während das radioaktive Material zunehmend seinen Tribut an der Gesundheit des Ehepaares fordert, verleiht ihnen die Royal Society die Davy-Medaille für die wichtigste chemische Entdeckung des Jahres 1903. Wenige Wochen später trifft ein Brief der Schwedischen Akademie der Wissenschaften ein: Gemeinsam mit Henri Becquerel erhalten die Curies für die Entdeckung der Strahlenphänomene den Nobelpreis für Physik.
Die letzten Jahre
1911 beschließt die Schwedische Akademie der Wissenschaften, Marie Curie den Nobelpreis für Chemie für die Entdeckung des Poloniums und des Radiums zu verleihen. Sie ist die erste Person, die zwei Nobelpreise in zwei Kategorien erhält.
Als der erste Weltkrieg in Europa ausbricht, hat Marie sich mit dem Gebiet der Radiologie vertraut gemacht. Sie erlernt den Umgang mit der Strahlenbehandlung und gibt diese Fähigkeit an andere weiter. Während in den Krankenhäusern wenig Strom und noch weniger Personal zur Verfügung steht, sterben an der Front Abertausende Franzosen. Also entwickelt Marie Curie eine fahrbare Röntgeneinrichtung, mit denen sie in unmittelbarer Nähe zur Front Soldaten behandeln kann.
Im Juli 1934 stirbt Marie Curie mit 67 Jahren an Blutarmut – eine Folge ihrer jahrelangen Forschungen an radioaktivem Material. Dass auch ihre Tochter Irène Joliot-Curie den Nobelpreis für Chemie erhält, erlebt sie nicht mehr. Während ihres Lebens hat ihr die französische Akademie der Wissenschaften stets die Mitgliedschaft verweigert. Nach der außerehelichen Beziehung zu Paul Langevin, einem weiteren bekannten Physiker, lange nach dem Tod ihres Mannes verschwindet die französische Begeisterung für die Forscherin außerdem. Marie war jetzt vor allem die Emanze, die intellektuelle Fremde. Obwohl Wissenschaftler der ganzen Welt, darunter Albert Einstein, Jean-Baptiste Perrin und Èmile Borel sie verteidigten, klebte der „Skandal“ für den Rest ihres Lebens an Marie Curie.
Dennoch konnte diese Frau Zeit ihres Lebens niemand aufhalten.