
4 Minuten Lesezeit
Wie wirken sich wirtschaftliche Trends auf Startup-Investitionen aus?
Schon gewusst?
Wirtschaftliche Trends wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit und der demografische Wandel beeinflussen stark, welche Startups erfolgreich sind. Investoren, die diese Trends erkennen, können gezielt in vielversprechende Branchen investieren und von zukünftigen Innovationen profitieren.

6 Minuten Lesezeit
Die Bedeutung von Netzwerken und Mentoren im Startup-Ökosystem
Schon gewusst?
Im Startup-Ökosystem reicht eine gute Idee allein oft nicht aus. Netzwerke und Mentoren spielen eine zentrale Rolle, indem sie Zugang zu Kapital, Know-how und strategischer Unterstützung bieten. Dieser Artikel zeigt, wie sie Gründer auf dem Weg zum Erfolg begleiten und nachhaltiges Wachstum ermöglichen.

8 Minuten Lesezeit
Die Zukunft der Fintech-Branche: Trends und Entwicklungen
Magazin
Die Fintech-Branche erlebt eine rasante Transformation, angetrieben durch bahnbrechende Technologien und innovative Geschäftsmodelle. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die aktuellen Trends und Entwicklungen, die die Zukunft der Fintech-Branche maßgeblich beeinflussen werden.

5 Minuten Lesezeit
Rechtsformen für Start-ups: Vor- und Nachteile im Überblick
Schon gewusst?
Die Wahl der richtigen Rechtsform ist für jedes Startup von zentraler Bedeutung, da sie rechtliche, steuerliche und strategische Aspekte beeinflusst. Dieser Artikel bietet einen umfassenden Überblick über die Vor- und Nachteile der gängigsten Rechtsformen für Startups in Deutschland.

3 Minuten Lesezeit
Das Companisto Legal Team im Fokus: Erfolge und Projekte im zweiten Quartal 2024
Companisto Inside
Das Legal Team von Companisto erlebte im zweiten Quartal 2024 erneut eine Zeit voller bemerkenswerter Fortschritte und Herausforderungen. Unter der fachkundigen Führung von Team Lead Daniel la Marca und Senior Legal Counsel Till Wedemann konnten bedeutende Meilensteine erreicht und richtungsweisende Projekte erfolgreich umgesetzt werden.

7 Minuten Lesezeit
Spar Tipps : Clevere Strategien für Ihre Investitionen
Magazin
In einer Zeit voller Konsumverlockungen ist es schwierig, Kapital für Investitionen zu finden. Doch finanzielle Unabhängigkeit erfordert gezielten Vermögensaufbau. Diese innovativen Spar-Tipps helfen Ihnen dabei.

6 Minuten Lesezeit
Die Bedeutung von Diversität und Inklusion in der Startup-Welt
Schon gewusst?
In einer sich ständig verändernden globalen Wirtschaft sind Startups das Rückgrat der Innovation. Sie treiben den Fortschritt voran, schaffen Arbeitsplätze und fördern wirtschaftliches Wachstum.

4 Minuten Lesezeit
Mythen und Wahrheiten über Startup-Investments: Eine Analyse der gängigsten Vorurteile
Magazin
Warum auch kleinere Beträge eine große Wirkung haben können

3 Minuten Lesezeit
Urban Farming: Die Evolution der Stadt-Landwirtschaft
Magazin
Urban Farming, ein Begriff, der die Vision einer nachhaltigen und grünen Zukunft inmitten urbaner Landschaften heraufbeschwört. Diese Bewegung, die die Trennlinien zwischen Stadt und Land verschwimmen lässt, ist mehr als nur ein Konzept - sie ist die Evolution der Stadt-Landwirtschaft.
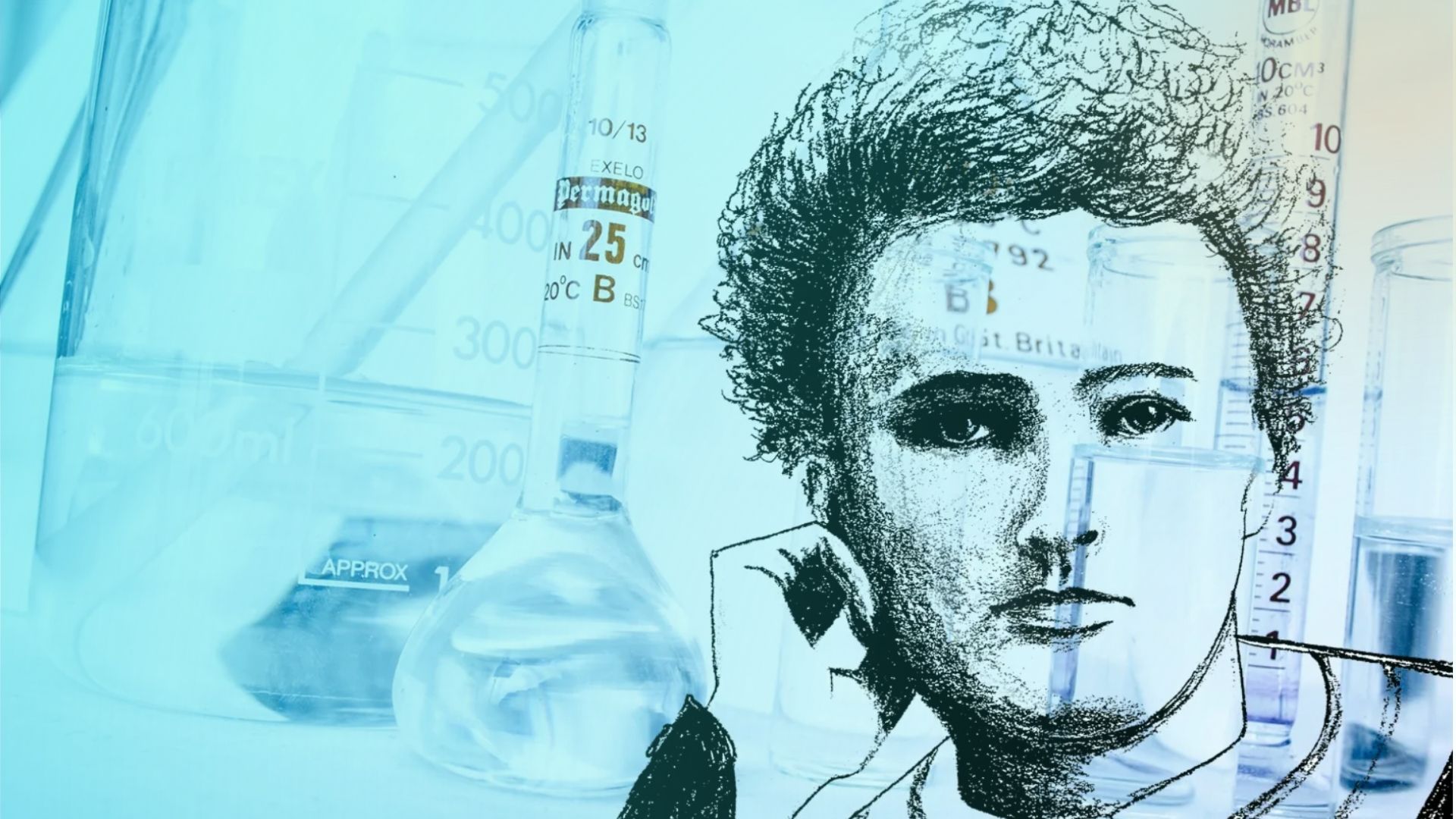
5 Minuten Lesezeit
Marie Curie: Eine Pionierin der Wissenschaft
Pionier-Serie
Sie war die erste Person, die in zwei Kategorien einen Nobelpreis erhielt. Sie war die erste Frau, die an der Pariser Sorbonne lehren durfte. Sie war diejenige, die das Polonium und das Radium entdeckte. Marie Curie und das Los, die Erste zu sein.

4 Minuten Lesezeit
Die Welt der Zukunftstechnologien
Magazin
Die Welt der Zukunftstechnologien bietet faszinierende Möglichkeiten, von KI bis Biotechnologie, und birgt gleichzeitig Herausforderungen wie ethische Bedenken und Veränderungen in der Arbeitswelt. Investitionen in Startups spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung dieser Technologien. Durch eine verantwortungsvolle Nutzung und Investitionen in Bildung können Zukunftstechnologien eine vielversprechende und positive Zukunft für alle ermöglichen.

3 Minuten Lesezeit
„House Party” mit EvoGolf: Wenn Investieren auf Golfen trifft!
News, Community & Events
Ein Tag voller Innovation und Begeisterung begann, als Investieren auf Golfen traf - ein Szenario, das durch das „House Party"-Format verwirklicht werden konnte. Das Event von EvoGolf war nicht nur eine Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre Kontakte zu knüpfen, sondern auch die Möglichkeit, in die Welt von EvoGolf einzutauchen. Diese gelungene Verbindung von Technologie, Networking und Golftraining versprach einen unvergesslichen Nachmittag voller Spaß, Inspiration und neuen Perspektiven.



